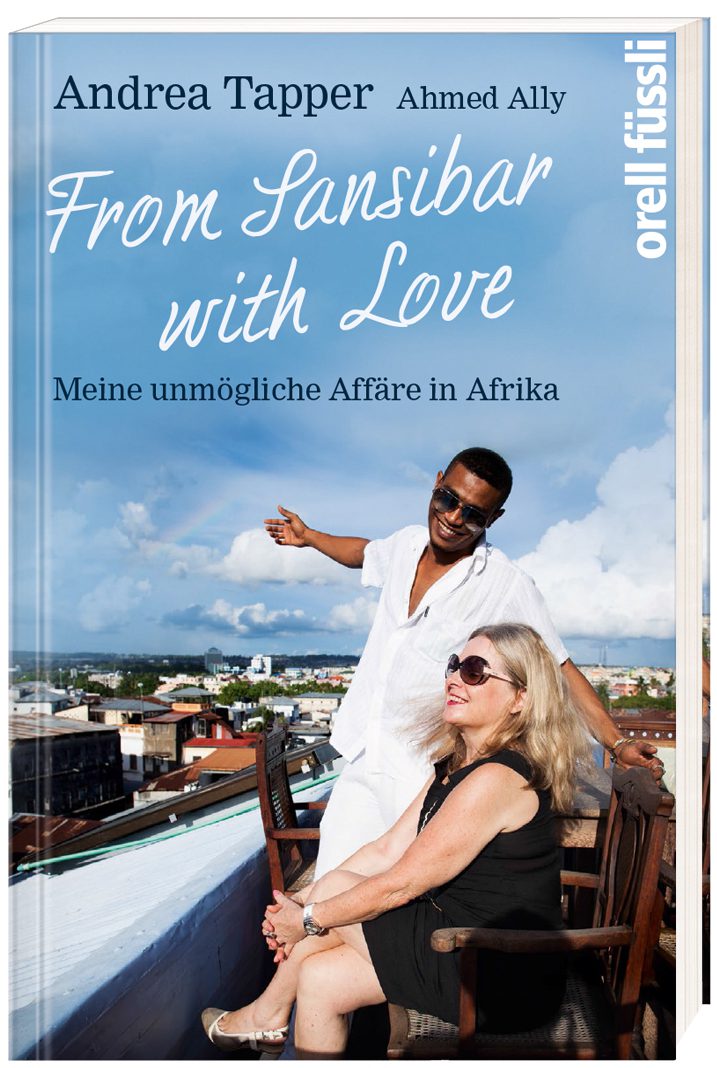Coronavirus: Reiche leben länger

CORONA DIARY ZANZIBAR (7)
Money makes the world go round – eine alte Erkenntnis, verfestigt in der HIV/AIDS-Epidemie, in der Mütter- und Säuglingssterblichkeit weltweit, und jetzt auch bei Corona: Wo kein Geld ist, wird schneller gestorben.

Bangen und hoffen im Ausland: Wie lange gibt’s aus dem ATM noch Geld?
Es ist ganz einfach: Wo es zu wenig Krankenbetten gibt, oder fast gar keine Intensivstationen, überleben weniger Schwerkranke. Logo, aber es geht noch weiter: Wo in beengten Verhältnissen gelebt wird – etwa in Zanzibar wohnen oft 4-8 Leute in einem Raum oder einer Hütte – bleibt „social distancing“ zwangsläufig ein Fremdwort.
Wer täglich raus muss, um ein paar Schilling als Tagelöhner auf dem Bau, Markt oder als Souvenirverkäufer zu verdienen, in Afrika bis zu 87 Prozent der Bevölkerung, und wer dann dieses Geld am Abend dann in Essbares umsetzt – der kann seit Corona weder zuhause bleiben, noch kann er seine täglichen Einkäufe reduzieren.
Selbst bei Hygienemaßnahmen zählt der Geldbeutel: Auch in Afrika gibt es zwar eine in Europa oft übersehene – stark wachsende – Mittelschicht (28 Prozent) und nicht wenige Superreiche; doch für viele andere stimmt immer noch, was der südafrikanische Researcher Alex Broadbent schrieb:

Eine der wenigen noch geöffneten Boutiquen: das Seifen und Wellnessparadies „Inaya“ verkauft ausschließlich handgemachte Öko-Produkte aus Zanzibar und Afrika. Das ist gut für den lokalen Markt, die Arbeiterinnen und die Zulieferer; die Zielgruppe sind eher Besserverdienende
„You can’t eat soap. If you are starving, you won’t buy it.“
Warum greife ich das Geld-Thema hier überhaupt auf? Weil ich es auch in meinem Alltag spüre. Ich bin nach Zanzibar u.a. deshalb gegangen, weil die Altstadt fußläufig ist und ich hier mit einem relativ geringen Budget eine Wohnung mieten und leben konnte – viel günstiger jedenfalls als etwa in afrikanischen Großstädten wie Nairobi oder Lagos, wo man Gärtner, Wachmann, Mieten ab etwa 1000 Euro und auf jeden Fall ein Auto miteinplanen muss.

Ein bißchen verbeult, aber Gold wert: mein Rave 4
Ein Auto gibt mir Sicherheit
Das hat sich geändert. Als hier der erste CORONA-Fall auftrat, habe ich mir als erstes ein Auto angeschafft, einen Wagen, den ich monatlich zum Freundschaftspreis von ca 300 Euro miete. Das Auto gibt mir Sicherheit und Freiheit; sonst müsste ich mit ständig wechselnden Taxifahrern in altersschwachen Autos mitfahren oder – jetzt völlig undenkbar – in „Dalla-Dalla“-Sammeltaxis eng zusammengepfercht sitzen. Viele, die dies noch immer müssen, tragen inzwischen Masken. Gute Arbeitgeber organisieren Privattransport für ihre Arbeiter. 70 000 Hotelangestelle sind mehr oder weniger arbeitslos. (Positiv: Obwohl selbst vor der Pleite stehend, haben viele Hoteliers ihre Angestellten erst mal in bezahlten oder unbezahlten Urlaub geschickt.)

Schleuderpartie: Vor dem Einstieg in ein Sammeltaxi wird vereinzelt Fieber gemessen, aber drinnen sitzt man dann doch eng gedrängt
Seit Corona habe ich mehr Ausgaben, weil ich einiges auf Vorrat gekauft habe. Weil die Preise etwa für „Sanitizer“, Desinfektionsmittel, sich verfünffacht haben. Ich habe meine Internet-Verbindung verbessert, damit ich weltweit Nachrichten hören kann. Als Nächstes steht an: ein DSTV TV-Abo, auch sinnvoll in einem Land, wo das Wort Presse gerne in Zusammenhang mit Zensur gebracht wird, und es kein einziges vernünftiges Fernsehprogramm gibt. Ich musste sogar ein doppeltes Rückflugticket erstehen, um eine bessere Chance auf einen Platz zu haben, wenn der Flughafen dann wieder geöffnet wird – was frühestens Ende Mai, Anfang Juni passieren könnte.

Übertragungsrisiko Cash: 10.000 Shilling sind umgerechnet knapp fünf Euro. Viele Afrikaner bezahlen per Handy-Überweisung zum Beispiel mit dem von einer Telefongesellschaft organisiertem „Ezypesa“. Solche Zahlsysteme sind in Afrika weiter entwickelt ist als in Europa
Airline-Büros: Verrammelt und verriegelt

Bis auf Weiteres geschlossen: Das Büro von Ethiopian Airlines in Zanzibar
Vergebens versuche ich in diesen Tagen mein Ticket zu updaten – oder überhaupt Neues über die Flugsituation zu erfahren: Die Airline-Büros (hier Ethiopian Airlines) sind einfach geschlossen. Kein Ansprechpartner mehr, sorry.
In den 90er Jahren – bevor es Medikamente gegen HIV/AIDS gab – sagte mir bei einer Reportage in Uganda der dortige Gesundheitsminister persönlich einmal folgenden Schlüsslsatz – auf meine Frage hin, warum AIDS die Armen mehr trifft:
If a man has a hole in his trousers, he is very likely to have a hole in his condom, too.“
Vorsichtsmaßnahmen sind ein Privileg der Privilegierten. Wir sollten täglich dafür dankbar sein.